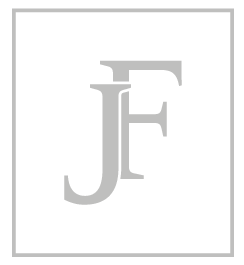Eine gute jüdische Erziehung? Ich weiß es nicht. Mein Mann Thomas und ich haben wirklich unser Bestes getan, aber ja, du weißt im Vorhinein natürlich nie genau, ob deine Kinder etwas davon annehmen. Zumindest: nicht bei unserem Sohn Lou, der während des Jüdischunterrichts meistens verkehrt herum auf seinem Sessel saß und zu Jom Kippur schon vor 11 Uhr wieder ein Jausenbrot aufgegessen hatte. Aber vor kurzer Zeit hat er uns doch überrascht.
Nachdem Lou das Konzept „mit dreißig Leuten in einer Klasse auf einem Sessel hinter einer Tafel sitzen“ während seiner Pubertät anfangs verworfen hatte, rief er uns eines Abends um seinen sechzehnten Geburtstag herum unerwartet zusammen, für ein gutes Gespräch.
„Ich hab meine ganze Jugend vergeudet“, weinte er. „Meine gaaaanze Juuuugend!“ Während andere Buben mit seinem Alter schon sowas wie ein akademisches Studium absolviert hatten, hatte er, Louden, außer seinem Schwimmdiplom nichts, womit er sich auszeichnen konnte. Die Botschaft: Er möchte wieder zurück zur Schule. Er entschied sich, nach langem Hin und Her, für die Berufsschule, auch „Grundausbildung“ genannt: Ein Platz, wo jeder, dem es bisher aus welchem Grund auch immer noch nicht gelungen ist, eine niederländische Startqualifikation erreichen kann. Schon am ersten Tag kam Lou ziemlich aufgeweckt von der Schule.
„Wie war’s?“, fragte ich. „Großartig,“ antwortete er. „Wir sind 26 Leute in der Klasse, die Umgangssprache ist Arabisch und ich bin mit den Palästinensern am WC gewesen.“ „So, so. Nun, das klingt wirklich nett.“ Er zögerte kurz. „Mama, was würdest du davon halten, wenn ich weniger mit den Palästinensern abhängen würde?“
Ich öffnete meinen Mund, bereit für eine Ermahnung über Vorurteile und die Gefahr von Verallgemeinerungen – … „sie wollen nämlich die ganze Zeit aufs WC und in den Toiletten werden alle Drogen verteilt.“ Ich schloss meinen Mund. „Darum dachte ich, dass ich vielleicht etwas mehr mit den Afghanen und iranischen Kurden umgehen sollte. Die sind supernett.“ „Das…., das scheint mir eine gute Idee zu sein“, sagte ich.
Zwei Wochen später sahen wir wie Louden in der Früh außer seinen Büchern und seiner Jause, auch seine Kippa einpackte. „Ich nehme meine Kippa mit,“ erklärte er schulterzuckend. „Während Bürgerrecht sprechen wir oft über den Glauben und die Identität. Fast niemand in meiner Klasse hat jemals in echt einen Juden gesehen. Sie hatten nicht gedacht, dass ich es war – jüdisch, meine ich. Vielleicht setze ich sie gar nicht auf, aber ich will sie auf jeden Fall mithaben.“
Zum ersten Mal schaute ich unseren Sohn durch die Augen eines Außenstehenden an: die große Gestalt, die selbstbewusste Haltung, das herzliche Lachen, die durch Kickboxen gestalteten Muskeln und die dunklen Augen. Ein beklemmendes Gefühl überkam mich, eine systemische Angst vor Enttarnung, vor Ausschluss und Verfolgung, gespeichert in den Zellen meines Körpers.
„Wenn du das willst, kannst du das machen“, sagte Thomas schließlich. Ein paar Tage später war ich gerade am Kochen, als die Hintertür aufging und Lou hereinstolperte. Er hatte blaue Flecken, hinkte und hatte eine Schwellung auf seiner Wange. Da haben wir’s schon. Meine größte Angst hat sich bestätigt.
„Mein Gott, was ist um Himmels Willen mit dir passiert?“, rief ich.
„Ich hab gekämpft.“
„Moses! Mit wem?“
„Mit den Kurden.“
„Aber das waren doch deine Freunde?“
„Stimmt. Wir haben im Fitnessstudio geboxt. Und sie waren besser.“
Und während er mühsam die Treppe hinaufging, um zu duschen, hörte ich ihn sagen: „Echt so toll. Morgen geh ich wieder.“